







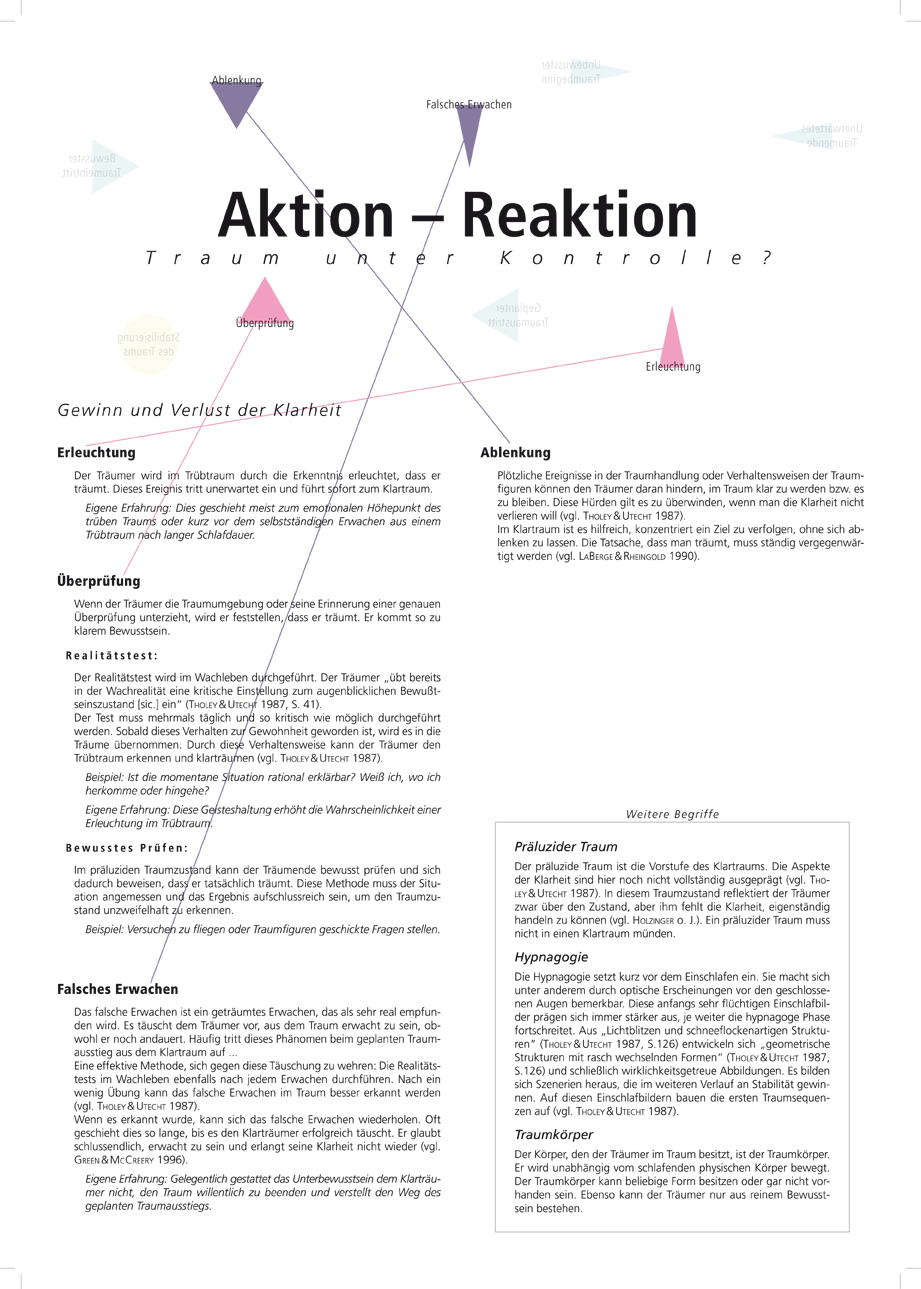

Die Kamelflüsterin
25. März 2012 etwa 0 Uhr
Ich schlafe ein. Stunden später beginnt dieser Traum:
Ich schlafe ein. Stunden später beginnt dieser Traum:
Vor mir erstreckt sich der Sandboden eines Recyclinghofs. Haufen aus Kompost und Pflanzenresten, die so hoch sind wie Häuser, türmen sich vor mir auf. Das Gelände ist menschenleer, trotzdem vernehme ich den Klang von schweren Maschinen. Aufgrund der enormen Menge biologischer Abfälle vermute ich, dass es Freitag oder Wochenende sein muss.
Wenige Meter hinter den Abfallhaufen stapeln sich sechs Frachtcontainer in drei Reihen, die stufenweise ansteigen. Der oberste Frachtcontainer in der höchsten und hintersten Reihe besitzt keine Wände, sondern besteht nur noch aus den Metallstreben an seinen Kanten. Von meinem Standpunkt aus kann ich die Ladung erkennen: Schweinekadaver, die teilweise verkrüppelt sind. Sie sehen aus, als wären sie über Wochen auf einem nassen Acker gelegen, ohne zu verwesen.
Ein blauer Greifarm aus Metall, der aus einer haushohen Maschine ragt, entlädt die Tierleichen und füllt sie in einen anderen Metallcontainer, der auf dem Boden steht. Mich graust der Anblick der toten Tiere, aber ich beobachte die Kadaver weiter um zu ergründen, wozu sie hierher gebracht wurden.
Meine Vermutung ist: Die missgebildeten Schweine wurden von Schlachtereien aussortiert und entsorgt, um hier umgeladen zu werden. Was danach mit ihnen geschieht, kann ich schwer erahnen.
Auf einmal verwandelt sich die Ladung mit Schweinen zu einem Haufen toter Kamele, zwischen denen brauner Seetang hängt. Aus dem Leichenberg ertönt ein entkräftetes Blöken. Eines der Kamele lebt!
Es kommt langsam zu sich, als würde es aus einer Vollnarkose erwachen. Die Greifer schnappen nach ihm. Doch das Tier strampelt und wehrt sich gegen seinen Abtransport. Es rutscht aus den eisernen Greifern der Maschine und fällt zurück auf den weichen Berg aus Kadavern. Das Kamel schleppt sich durch die Öffnung der Metallstreben und stolpert die Treppe aus Containern hinab. Dumpf schlägt es auf dem sandigen Grund auf. In Freiheit und zu Kräften gekommen, trabt es los – direkt zu mir.
Um mich hat sich bereits ein Pulk von Arbeitern und Schaulustigen gebildet, die das Spektakel begaffen. Gemurmel erhebt sich, aber keiner der Zuschauer schreitet ein.
Mit zuckenden Bewegungen und schäumendem Maul galoppiert das Kamel weiter auf mich zu. Immer deutlicher erkenne ich bösartige Auswüchse an seinem Körper: Tollwut oder ein schwerer Gendefekt?
Ich möchte das kranke Tier unbedingt näher begutachten und zücke meine Digitalkamera aus der rechten Hosentasche meiner Cordhose. Mit gedrücktem Zoomhebel richte ich das Objektiv auf das Kamel. Sofort betätige ich den Auslöser und nehme das Bild auf dem Display unter die Lupe.
Das Kamel auf dem Foto hat sich abermals verändert: Auf drei verrenkten Hälsen sitzen drei Köpfe, die im Wahn Fratzen schneiden. Der Körper des Wesens ist übersät mit Warzen und seine Tumore sind jetzt noch stärker ausgeprägt.
Plötzlich treten aus der Menschenmenge drei Prostituierte hervor. Sie fangen die wilde Kreatur ab und bringen sie zum Stehen. Die groß gewachsene Anführerin streichelt zärtlich über das braune Fell am Hals des Kamels und flüstert ihm beruhigende Worte ins Ohr.
Die Prostituierten ziehen Schnapsgläser und Flaschen mit klarem Alkohol unter ihren Strapsen hervor. Sie trinken und flößen dem Kamel aus der Flasche ein. Das Gelage artet aus, bis das Tier völlig betrunken ist und die Prostituierten sich lüsternd mit Schnaps überschütten.
Die Menschenmenge – unter ihnen viele Japaner – johlt und fotografiert das Geschehen.
In diesem Moment habe ich eine Erleuchtung und begreife, dass alles nur ein Traum ist.
Ich erinnere mich an das, was ich vor dem Einschlafen beschlossen habe: Im Klartraum mit einer Traumfigur in Kontakt zu treten und sie um einen Gedichtvortrag zu bitten.
Die Anführerin der Prostituierten erscheint mir fähig, die Situation besonders gut in lyrischer Form beschreiben zu können. Ich befürchte, auf meine Bitte hin beleidigt und vor allen Leuten bloßgestellt zu werden, überwinde aber meine Scheu vor einem Misserfolg. Ich steuere auf die Frau zu, die immer attraktiver wird:
Ihr erhabenes Gesicht thront auf hohen Schultern. Ihrer edlen Stirn entspringt schwarzes Haar, das zu einem Zopf gebunden bis zu den Hüften reicht. An den geschwungenen Ohren hängen Creolen und ihre wachen Augen leuchten grün.
Obwohl mich ihre Eleganz einschüchtert, gehe ich weiter. Eigentlich müsste die Prostituierte meine Schritte längst gehört haben, doch sie ignoriert mich gekonnt. Sie dreht mir den Rücken zu und diskutiert mit den anderen Frauen. Angespannt tippe ich ihr auf die Schulter und bitte sie um ein spontanes Gedicht. Ihre Mimik erhellt sich, ganz so als wäre ich ein alter Freund. Es sprudelt aus ihr heraus:
Wenige Meter hinter den Abfallhaufen stapeln sich sechs Frachtcontainer in drei Reihen, die stufenweise ansteigen. Der oberste Frachtcontainer in der höchsten und hintersten Reihe besitzt keine Wände, sondern besteht nur noch aus den Metallstreben an seinen Kanten. Von meinem Standpunkt aus kann ich die Ladung erkennen: Schweinekadaver, die teilweise verkrüppelt sind. Sie sehen aus, als wären sie über Wochen auf einem nassen Acker gelegen, ohne zu verwesen.
Ein blauer Greifarm aus Metall, der aus einer haushohen Maschine ragt, entlädt die Tierleichen und füllt sie in einen anderen Metallcontainer, der auf dem Boden steht. Mich graust der Anblick der toten Tiere, aber ich beobachte die Kadaver weiter um zu ergründen, wozu sie hierher gebracht wurden.
Meine Vermutung ist: Die missgebildeten Schweine wurden von Schlachtereien aussortiert und entsorgt, um hier umgeladen zu werden. Was danach mit ihnen geschieht, kann ich schwer erahnen.
Auf einmal verwandelt sich die Ladung mit Schweinen zu einem Haufen toter Kamele, zwischen denen brauner Seetang hängt. Aus dem Leichenberg ertönt ein entkräftetes Blöken. Eines der Kamele lebt!
Es kommt langsam zu sich, als würde es aus einer Vollnarkose erwachen. Die Greifer schnappen nach ihm. Doch das Tier strampelt und wehrt sich gegen seinen Abtransport. Es rutscht aus den eisernen Greifern der Maschine und fällt zurück auf den weichen Berg aus Kadavern. Das Kamel schleppt sich durch die Öffnung der Metallstreben und stolpert die Treppe aus Containern hinab. Dumpf schlägt es auf dem sandigen Grund auf. In Freiheit und zu Kräften gekommen, trabt es los – direkt zu mir.
Um mich hat sich bereits ein Pulk von Arbeitern und Schaulustigen gebildet, die das Spektakel begaffen. Gemurmel erhebt sich, aber keiner der Zuschauer schreitet ein.
Mit zuckenden Bewegungen und schäumendem Maul galoppiert das Kamel weiter auf mich zu. Immer deutlicher erkenne ich bösartige Auswüchse an seinem Körper: Tollwut oder ein schwerer Gendefekt?
Ich möchte das kranke Tier unbedingt näher begutachten und zücke meine Digitalkamera aus der rechten Hosentasche meiner Cordhose. Mit gedrücktem Zoomhebel richte ich das Objektiv auf das Kamel. Sofort betätige ich den Auslöser und nehme das Bild auf dem Display unter die Lupe.
Das Kamel auf dem Foto hat sich abermals verändert: Auf drei verrenkten Hälsen sitzen drei Köpfe, die im Wahn Fratzen schneiden. Der Körper des Wesens ist übersät mit Warzen und seine Tumore sind jetzt noch stärker ausgeprägt.
Plötzlich treten aus der Menschenmenge drei Prostituierte hervor. Sie fangen die wilde Kreatur ab und bringen sie zum Stehen. Die groß gewachsene Anführerin streichelt zärtlich über das braune Fell am Hals des Kamels und flüstert ihm beruhigende Worte ins Ohr.
Die Prostituierten ziehen Schnapsgläser und Flaschen mit klarem Alkohol unter ihren Strapsen hervor. Sie trinken und flößen dem Kamel aus der Flasche ein. Das Gelage artet aus, bis das Tier völlig betrunken ist und die Prostituierten sich lüsternd mit Schnaps überschütten.
Die Menschenmenge – unter ihnen viele Japaner – johlt und fotografiert das Geschehen.
In diesem Moment habe ich eine Erleuchtung und begreife, dass alles nur ein Traum ist.
Ich erinnere mich an das, was ich vor dem Einschlafen beschlossen habe: Im Klartraum mit einer Traumfigur in Kontakt zu treten und sie um einen Gedichtvortrag zu bitten.
Die Anführerin der Prostituierten erscheint mir fähig, die Situation besonders gut in lyrischer Form beschreiben zu können. Ich befürchte, auf meine Bitte hin beleidigt und vor allen Leuten bloßgestellt zu werden, überwinde aber meine Scheu vor einem Misserfolg. Ich steuere auf die Frau zu, die immer attraktiver wird:
Ihr erhabenes Gesicht thront auf hohen Schultern. Ihrer edlen Stirn entspringt schwarzes Haar, das zu einem Zopf gebunden bis zu den Hüften reicht. An den geschwungenen Ohren hängen Creolen und ihre wachen Augen leuchten grün.
Obwohl mich ihre Eleganz einschüchtert, gehe ich weiter. Eigentlich müsste die Prostituierte meine Schritte längst gehört haben, doch sie ignoriert mich gekonnt. Sie dreht mir den Rücken zu und diskutiert mit den anderen Frauen. Angespannt tippe ich ihr auf die Schulter und bitte sie um ein spontanes Gedicht. Ihre Mimik erhellt sich, ganz so als wäre ich ein alter Freund. Es sprudelt aus ihr heraus:
"Den Baggermann hat‘s blöd getroffen –
durch ein großes Doof ersoffen."
durch ein großes Doof ersoffen."
Die Prostituierte hält inne. Sie fordert mich mit eindringlichen Blicken auf, etwas zu ihrem Werk zu sagen. Aber vorher erkundige ich mich nach dem Sinn des letzten Satzteils.
„Ist in deinem letzten Satz ein Fehler drin?“, hake ich nach.
Sie entgegnet: „Nein, nein, das hab‘ ich schon richtig gesagt! Ein ,Doof‘ ist ein Synonym für Ungeschick.“
Die Wortschöpfung der Traumfigur begeistert mich und ich umarme sie. Vor Freude über das gelungene Experiment erwäge ich nicht, mich sofort aufzuwecken, um die Worte schriftlich festzuhalten ...
„Ist in deinem letzten Satz ein Fehler drin?“, hake ich nach.
Sie entgegnet: „Nein, nein, das hab‘ ich schon richtig gesagt! Ein ,Doof‘ ist ein Synonym für Ungeschick.“
Die Wortschöpfung der Traumfigur begeistert mich und ich umarme sie. Vor Freude über das gelungene Experiment erwäge ich nicht, mich sofort aufzuwecken, um die Worte schriftlich festzuhalten ...
25. März 2012 8.59 Uhr
Erst viel später erwache ich von selbst. Da ich mich noch an zwei nachfolgende Träume erinnern kann, schätze ich, dass dieser Klartraum in etwa drei Stunden zurück liegt. Die Erinnerung an die Ereignisse sind trotzdem noch deutlich und den genauen Wortlaut des Gedichts habe ich nicht vergessen.
Das Experiment ist geglückt: In meinen weiteren Klarträumen werde ich mich auf die Suche nach Traumfiguren begeben und diese um einen lyrischen Vortrag bitten.
Erst viel später erwache ich von selbst. Da ich mich noch an zwei nachfolgende Träume erinnern kann, schätze ich, dass dieser Klartraum in etwa drei Stunden zurück liegt. Die Erinnerung an die Ereignisse sind trotzdem noch deutlich und den genauen Wortlaut des Gedichts habe ich nicht vergessen.
Das Experiment ist geglückt: In meinen weiteren Klarträumen werde ich mich auf die Suche nach Traumfiguren begeben und diese um einen lyrischen Vortrag bitten.

Zugriff!
30. Mai 2012 etwa 4 Uhr
Übermüdet schlafe ich ein. Stunden später beginnt dieser Traum:
Übermüdet schlafe ich ein. Stunden später beginnt dieser Traum:
Ich stehe im Wohnzimmer meines Vaters. Der Raum liegt im Bauch eines großen Segelschiffs. Die Wände des Zimmers sind mit dunklem Holz vertäfelt und dicke Balken stützen die hölzerne Zimmerdecke, über der das Schiffsdeck verläuft. Die Sessel und Couchgarnituren werden von schummrigen Lampen beleuchtet und tauchen das Wohnzimmer in behagliches Licht. Ich fühle mich zuhause und geborgen.
Im hinteren Teil des Raums sitzt mein Vater in einem Sessel und liest ein Buch. Ich gehe auf ihn zu und setze mich auf das Sofa gegenüber. Er sieht er auf und legt sein Buch zur Seite. Wir kommen ins Gespräch.
„Wie laufen die Experimente in deinen Klarträumen?“, erkundigt er sich.
Verlegen muss ich zugeben, dass ich meine Erfolge noch nicht steigern konnte und nur im Wochentakt ein neues Gedicht im Klartraum erzeugen kann. Ich ernte einen enttäuschten Blick von ihm.
„Doch nur, weil du in Wahrheit Angst davor hast“, schließt er.
Ich ärgere mich und schimpfe: „Du bist wie Mutter! Sie wollte mir früher auch einreden, dass ich Angst davor hätte, von Zuhause auszuziehen. Und dass ich deswegen wohl ständig schlecht träume. Ich kann die Scheiße nicht mehr hören!“
Mein Ärger schlägt in Wut um.
„Jeder unterstellt mir irgendwelche Ängste! Wovor soll ich im Klartraum Angst haben? Wenn ich doch dabei weiß, dass ich träume!“
Ich werde immer zorniger und erhebe mich vom Sofa.
„Habe ich denn vor irgendetwas Angst?“, zische ich und gehe drohend auf ihn zu.
Vater antwortet nicht. Noch immer sitzt er in derselben Position in seinem Sessel. Aber der Ausdruck in seinen Augen teilt mir mit, dass er verstanden hat. Jetzt bedauere ich fast meinen Wutausbruch, doch ich drehe ihm den Rücken zu und verlasse das Wohnzimmer. Sein abfälliger Kommentar hat mich zu sehr verärgert.
Während ich durch einen dunklen Korridor laufe, denke ich nach: Wovor habe ich eigentlich Angst?
Ich male mir eine Schlägerei aus, in der ich umkomme. Dabei versuche ich herauszufinden, ob ich diesen Moment am meisten fürchte.
Um die Ecke, am Ende des Korridors, scheint Licht. Ich laufe darauf zu und biege in einen anderen Raum ab: In die Küche. Meine Mutter backt Brote.
Die Backluft des Ofens steigt mir freundlich in die Nase. Angetan schnüffele ich und möchte meinen Ärger mit etwas Leckerem besänftigen. Neben meiner Mutter, die mit dem Rücken zu mir an der Küchentheke hantiert, stapeln sich Backbleche von der Arbeitsplatte bis zur Küchendecke. Auf jedem der Bleche liegt ein frisches Weißbrot, das mit einem Stück cremefarbenem Backpapier umwickelt ist. Die Brotlaibe sind nicht viel höher als Baguettes, bedecken aber mit ihrer ovalen Form die gesamte Fläche der Backbleche. An ihren Enden verjüngen sich die Laibe zu knusprigen braunen Zipfeln, wie die einer krossen Laugenbreze. Auf die hellbraune Kruste ist feines Mehl gepudert.
Angetan schmatze ich und mein Mund wird so wässrig, dass ich sofort zugreifen muss. Auf Zehenspitzen fingere ich nach einem der Weißbrote, das zuoberst des Stapels liegt und über dessen Kante hinausragt.
Es bricht auseinander. Seine Papierhülle zerreißt und ich halte nur noch den knusprigen Zipfel in meinen Fingern. Beinahe wäre der ganze Turm aus Broten und Blechen zusammengestürzt.
Mutter betrachtet mich nachdenklich.
Ich knurre und knirsche mit den Zähnen. Völlig gereizt verlasse ich die Küche.
Auf einmal komme ich an einem anderen Ort zu mir: Ich hocke hinter einem Stromkasten.
Es ist Nacht. Eine Lagerhalle auf dem Industriegelände hinter mir ist mein Ziel. Ohne gesehen zu werden, will ich das Gelände betreten und in die Werkshalle einbrechen. Ich kauere hinter dem weißen Elektrokasten, um die letzten Autos auf der Straße abzuwarten. An der Seite des Kastens luge ich hervor und beobachte den Verkehr durch die Löcher meiner Sturmmaske.
Die Straße vor mir ist nur auf hundert Metern Länge einsehbar. Ihr weiterer Verlauf ist hinter dichten Baumreihen verborgen. Mehrmals zucke ich, um loszurennen, aber jedes Mal reiße ich mich wieder zurück. Denn ständig kündigt ein schwacher Schein eines entfernten Frontlichts das nächste Fahrzeug an. Obwohl es mitten in der Nacht ist, nimmt die Autoschlange kein Ende. Ich verstehe die Situation nicht mehr: Warum sind noch so viele Autofahrer auf den Straßen?
Notgedrungen harre ich aus und beschließe, auf eine passende Gelegenheit zu warten. Mit einem Mal erkenne ich jedoch, dass der Stromkasten viel zu nah an der Straße steht und ich von den Seiten leicht zu sehen bin. Jeder der Autofahrer könnte mich bereits entdeckt haben. Fassungslos frage ich mich, wie ich so einen dummen Fehler begehen konnte. Mein Herz klopft schneller. Unter der schwarzen Maske aus Stoff wird mir immer heißer. Mein nervöser Atem kondensiert an der muffigen Baumwolle.
Plötzlich vibriert es in meiner Hosentasche. Meine Augen weiten sich vor Entsetzen. Ich muss mein Handy versehentlich mitgenommen haben. Ich wage es nicht, mich zu rühren.
Der Anrufer legt nicht auf. Jetzt habe ich das Telefon eh schon dabei – Ich muss herausfinden, wer mich erreichen will. In Handschuhen fingere ich mein Handy aus der Hosentasche.
Auf dem blauen Display leuchtet: Papa
Ich gefriere vor Schock. Will er mich warnen? Oder will er sich nur wegen vorhin entschuldigen?
Fieberhaft überlege ich in alle Richtungen. Ich erwäge den Anruf anzunehmen, aber denke an die Vorratsdatenspeicherung meines Telefonanbieters. Meine Anwesenheit zum Zeitpunkt des Gesprächs könnte der Polizei dienlich sein und leicht zurückverfolgt werden.
Es vibriert weiter. Die Situation wächst mir über den Kopf – außerdem halte ich mich für mein kriminelles Vorhaben schon viel zu lange hier auf. Ich kann keinen klaren Gedanken mehr fassen und starre auf die weiße Rückwand des Stromkastens.
Endlich verstummt das Telefon.
Der Verkehr gibt eine Lücke frei und ich schnelle hinter dem Kasten hervor. Ich renne über die Straße, bis mir auffällt, dass dies die falsche Richtung ist. Ich bin so nervös, dass ich gar nicht mehr weiß, wo ich eigentlich hingehen wollte. Mitten auf dem Grünstreifen mache ich kehrt und haste im Lichtkegel von vier Autos zu meinem Ausgangspunkt zurück. Alles läuft schief. Am Horizont graut der Morgen.
Ich bin sicher entdeckt worden, aber breche meine Unternehmung nicht ab – ich renne weiter. Ich blicke an meiner schwarzen Kleidung herunter und auf einmal halte ich auch noch eine Kameratasche in der rechten Hand. Der Rucksack mit dem Werkzeug wird immer schwerer. Die Last droht mich in die Knie zu zwingen.
Unter schwerem Schnaufen schleppe ich mich am Stromkasten vorbei und halte auf das geöffnete Schiebetor des Geländes zu ...
Kurz vor dem Tor schweift mein Blick zufällig auf einen Seitenweg, der versteckt durch die Bäume führt. Dort erhasche ich die Silhouette eines Wagens. Ohne Licht schleicht er heran. Ein BMW-Kombi. Auf dem silbernen Lack schimmern zwei grüne Streifen. Ein roter verläuft darüber. Eine Spezialstreife.
Vor Schreck knicke ich ein – aber sprinte sofort weiter. Der Wagen hat mich entdeckt. Er rollt auf dem knirschenden Kies näher – Der Rückweg ist verstellt. Ich muss aufs Gelände flüchten.
Mit all dem klappernden Gepäck renne ich durch das Industrietor. Gerade noch rechtzeitig bremse ich ab, bevor ich gegen das Heck eines weiteren Wagens pralle. Noch ein Polizeiauto. Die Lichter sind abgeblendet aber die roten Rückleuchten glimmen gefährlich. Doch kein Schreien, kein Polizist, der mich verhaftet. Ich ducke mich und gehe hinter dem Kofferraumdeckel in Deckung.
Ich halte die Luft an, bis meine Lungen zu platzen drohen. Nichts passiert. Vorsichtig richte ich mich auf. Durch die Heckscheibe spähe ich ins Innere des Wagens:
Das Rauschen in meinem Kopf macht mich taub. Die Vordersitze des BMW-Kombis sind in Liegestellung. Auf den schwarzen Lederpolstern liegen ein Polizist und eine Polizistin – regungslos. Durch die Heckscheibe erkenne ich das Blitzen von Metall in ihren Händen. Mit versteinerter Miene kauern die Polizisten auf den Ledersitzen. Sie lauern und warten auf mich – die Waffen geladen, bereit zum Schuss ...
Die Panik packt mich am Kragen. Ich sitze in der Falle.
Doch plötzlich begreife ich, dass alles nur ein Traum ist.
Der Schreck sitzt noch so tief, dass ich einige Atemstöße brauche, um das Erlebnis zu verdauen. Zögerlich übermannt mich die Erleichterung. Sogleich erinnere ich mich an meine Mission: Einen Dichter aufsuchen. Mich interessiert besonders, was der Einsatzleiter zu sagen hat und ich mache mich auf den Weg, ihn ausfindig zu machen. Er muss hier auf dem Industriegelände sein und die Operation koordinieren.
Gemächlich laufe ich um das Auto, in dem die Polizisten kauern und schlendere weiter über das Gelände. Überall erscheinen Polizisten, die mich im Licht der Morgendämmerung reglos mustern. Diese Gelegenheit will ich nicht verschenken, ich darf nicht riskieren, zu früh aus dem Traum zu fallen. Während ich weitergehe, zwinkere ich, um den Traum stabil zu halten und nicht vorschnell zu erwachen. Jedes Mal wenn ich meine Lider wieder öffne, hat sich die Umgebung ein kleines Stück verändert. Weitere uniformierte Beamten erscheinen und vor mir taucht der Anhänger eines LKWs auf. An jeder Ecke des Hängers ist eine polizeiliche Sicherheitskraft positioniert.
Im Laderaum erkenne ich die Uniform eines hochrangigen Beamten. Der Einsatzleiter steht im Inneren. Lässig lehnt er mit dem Rücken an der hinteren Wand des Hängers und erwartet mich. Ich täusche vor, mich gleich ergeben zu wollen, aber verlange als Gegenleistung einen lyrischen Text von ihm. Der Einsatzleiter hebt bedächtig sein Megafon zum Mund und raunt hinein:
Im hinteren Teil des Raums sitzt mein Vater in einem Sessel und liest ein Buch. Ich gehe auf ihn zu und setze mich auf das Sofa gegenüber. Er sieht er auf und legt sein Buch zur Seite. Wir kommen ins Gespräch.
„Wie laufen die Experimente in deinen Klarträumen?“, erkundigt er sich.
Verlegen muss ich zugeben, dass ich meine Erfolge noch nicht steigern konnte und nur im Wochentakt ein neues Gedicht im Klartraum erzeugen kann. Ich ernte einen enttäuschten Blick von ihm.
„Doch nur, weil du in Wahrheit Angst davor hast“, schließt er.
Ich ärgere mich und schimpfe: „Du bist wie Mutter! Sie wollte mir früher auch einreden, dass ich Angst davor hätte, von Zuhause auszuziehen. Und dass ich deswegen wohl ständig schlecht träume. Ich kann die Scheiße nicht mehr hören!“
Mein Ärger schlägt in Wut um.
„Jeder unterstellt mir irgendwelche Ängste! Wovor soll ich im Klartraum Angst haben? Wenn ich doch dabei weiß, dass ich träume!“
Ich werde immer zorniger und erhebe mich vom Sofa.
„Habe ich denn vor irgendetwas Angst?“, zische ich und gehe drohend auf ihn zu.
Vater antwortet nicht. Noch immer sitzt er in derselben Position in seinem Sessel. Aber der Ausdruck in seinen Augen teilt mir mit, dass er verstanden hat. Jetzt bedauere ich fast meinen Wutausbruch, doch ich drehe ihm den Rücken zu und verlasse das Wohnzimmer. Sein abfälliger Kommentar hat mich zu sehr verärgert.
Während ich durch einen dunklen Korridor laufe, denke ich nach: Wovor habe ich eigentlich Angst?
Ich male mir eine Schlägerei aus, in der ich umkomme. Dabei versuche ich herauszufinden, ob ich diesen Moment am meisten fürchte.
Um die Ecke, am Ende des Korridors, scheint Licht. Ich laufe darauf zu und biege in einen anderen Raum ab: In die Küche. Meine Mutter backt Brote.
Die Backluft des Ofens steigt mir freundlich in die Nase. Angetan schnüffele ich und möchte meinen Ärger mit etwas Leckerem besänftigen. Neben meiner Mutter, die mit dem Rücken zu mir an der Küchentheke hantiert, stapeln sich Backbleche von der Arbeitsplatte bis zur Küchendecke. Auf jedem der Bleche liegt ein frisches Weißbrot, das mit einem Stück cremefarbenem Backpapier umwickelt ist. Die Brotlaibe sind nicht viel höher als Baguettes, bedecken aber mit ihrer ovalen Form die gesamte Fläche der Backbleche. An ihren Enden verjüngen sich die Laibe zu knusprigen braunen Zipfeln, wie die einer krossen Laugenbreze. Auf die hellbraune Kruste ist feines Mehl gepudert.
Angetan schmatze ich und mein Mund wird so wässrig, dass ich sofort zugreifen muss. Auf Zehenspitzen fingere ich nach einem der Weißbrote, das zuoberst des Stapels liegt und über dessen Kante hinausragt.
Es bricht auseinander. Seine Papierhülle zerreißt und ich halte nur noch den knusprigen Zipfel in meinen Fingern. Beinahe wäre der ganze Turm aus Broten und Blechen zusammengestürzt.
Mutter betrachtet mich nachdenklich.
Ich knurre und knirsche mit den Zähnen. Völlig gereizt verlasse ich die Küche.
Auf einmal komme ich an einem anderen Ort zu mir: Ich hocke hinter einem Stromkasten.
Es ist Nacht. Eine Lagerhalle auf dem Industriegelände hinter mir ist mein Ziel. Ohne gesehen zu werden, will ich das Gelände betreten und in die Werkshalle einbrechen. Ich kauere hinter dem weißen Elektrokasten, um die letzten Autos auf der Straße abzuwarten. An der Seite des Kastens luge ich hervor und beobachte den Verkehr durch die Löcher meiner Sturmmaske.
Die Straße vor mir ist nur auf hundert Metern Länge einsehbar. Ihr weiterer Verlauf ist hinter dichten Baumreihen verborgen. Mehrmals zucke ich, um loszurennen, aber jedes Mal reiße ich mich wieder zurück. Denn ständig kündigt ein schwacher Schein eines entfernten Frontlichts das nächste Fahrzeug an. Obwohl es mitten in der Nacht ist, nimmt die Autoschlange kein Ende. Ich verstehe die Situation nicht mehr: Warum sind noch so viele Autofahrer auf den Straßen?
Notgedrungen harre ich aus und beschließe, auf eine passende Gelegenheit zu warten. Mit einem Mal erkenne ich jedoch, dass der Stromkasten viel zu nah an der Straße steht und ich von den Seiten leicht zu sehen bin. Jeder der Autofahrer könnte mich bereits entdeckt haben. Fassungslos frage ich mich, wie ich so einen dummen Fehler begehen konnte. Mein Herz klopft schneller. Unter der schwarzen Maske aus Stoff wird mir immer heißer. Mein nervöser Atem kondensiert an der muffigen Baumwolle.
Plötzlich vibriert es in meiner Hosentasche. Meine Augen weiten sich vor Entsetzen. Ich muss mein Handy versehentlich mitgenommen haben. Ich wage es nicht, mich zu rühren.
Der Anrufer legt nicht auf. Jetzt habe ich das Telefon eh schon dabei – Ich muss herausfinden, wer mich erreichen will. In Handschuhen fingere ich mein Handy aus der Hosentasche.
Auf dem blauen Display leuchtet: Papa
Ich gefriere vor Schock. Will er mich warnen? Oder will er sich nur wegen vorhin entschuldigen?
Fieberhaft überlege ich in alle Richtungen. Ich erwäge den Anruf anzunehmen, aber denke an die Vorratsdatenspeicherung meines Telefonanbieters. Meine Anwesenheit zum Zeitpunkt des Gesprächs könnte der Polizei dienlich sein und leicht zurückverfolgt werden.
Es vibriert weiter. Die Situation wächst mir über den Kopf – außerdem halte ich mich für mein kriminelles Vorhaben schon viel zu lange hier auf. Ich kann keinen klaren Gedanken mehr fassen und starre auf die weiße Rückwand des Stromkastens.
Endlich verstummt das Telefon.
Der Verkehr gibt eine Lücke frei und ich schnelle hinter dem Kasten hervor. Ich renne über die Straße, bis mir auffällt, dass dies die falsche Richtung ist. Ich bin so nervös, dass ich gar nicht mehr weiß, wo ich eigentlich hingehen wollte. Mitten auf dem Grünstreifen mache ich kehrt und haste im Lichtkegel von vier Autos zu meinem Ausgangspunkt zurück. Alles läuft schief. Am Horizont graut der Morgen.
Ich bin sicher entdeckt worden, aber breche meine Unternehmung nicht ab – ich renne weiter. Ich blicke an meiner schwarzen Kleidung herunter und auf einmal halte ich auch noch eine Kameratasche in der rechten Hand. Der Rucksack mit dem Werkzeug wird immer schwerer. Die Last droht mich in die Knie zu zwingen.
Unter schwerem Schnaufen schleppe ich mich am Stromkasten vorbei und halte auf das geöffnete Schiebetor des Geländes zu ...
Kurz vor dem Tor schweift mein Blick zufällig auf einen Seitenweg, der versteckt durch die Bäume führt. Dort erhasche ich die Silhouette eines Wagens. Ohne Licht schleicht er heran. Ein BMW-Kombi. Auf dem silbernen Lack schimmern zwei grüne Streifen. Ein roter verläuft darüber. Eine Spezialstreife.
Vor Schreck knicke ich ein – aber sprinte sofort weiter. Der Wagen hat mich entdeckt. Er rollt auf dem knirschenden Kies näher – Der Rückweg ist verstellt. Ich muss aufs Gelände flüchten.
Mit all dem klappernden Gepäck renne ich durch das Industrietor. Gerade noch rechtzeitig bremse ich ab, bevor ich gegen das Heck eines weiteren Wagens pralle. Noch ein Polizeiauto. Die Lichter sind abgeblendet aber die roten Rückleuchten glimmen gefährlich. Doch kein Schreien, kein Polizist, der mich verhaftet. Ich ducke mich und gehe hinter dem Kofferraumdeckel in Deckung.
Ich halte die Luft an, bis meine Lungen zu platzen drohen. Nichts passiert. Vorsichtig richte ich mich auf. Durch die Heckscheibe spähe ich ins Innere des Wagens:
Das Rauschen in meinem Kopf macht mich taub. Die Vordersitze des BMW-Kombis sind in Liegestellung. Auf den schwarzen Lederpolstern liegen ein Polizist und eine Polizistin – regungslos. Durch die Heckscheibe erkenne ich das Blitzen von Metall in ihren Händen. Mit versteinerter Miene kauern die Polizisten auf den Ledersitzen. Sie lauern und warten auf mich – die Waffen geladen, bereit zum Schuss ...
Die Panik packt mich am Kragen. Ich sitze in der Falle.
Doch plötzlich begreife ich, dass alles nur ein Traum ist.
Der Schreck sitzt noch so tief, dass ich einige Atemstöße brauche, um das Erlebnis zu verdauen. Zögerlich übermannt mich die Erleichterung. Sogleich erinnere ich mich an meine Mission: Einen Dichter aufsuchen. Mich interessiert besonders, was der Einsatzleiter zu sagen hat und ich mache mich auf den Weg, ihn ausfindig zu machen. Er muss hier auf dem Industriegelände sein und die Operation koordinieren.
Gemächlich laufe ich um das Auto, in dem die Polizisten kauern und schlendere weiter über das Gelände. Überall erscheinen Polizisten, die mich im Licht der Morgendämmerung reglos mustern. Diese Gelegenheit will ich nicht verschenken, ich darf nicht riskieren, zu früh aus dem Traum zu fallen. Während ich weitergehe, zwinkere ich, um den Traum stabil zu halten und nicht vorschnell zu erwachen. Jedes Mal wenn ich meine Lider wieder öffne, hat sich die Umgebung ein kleines Stück verändert. Weitere uniformierte Beamten erscheinen und vor mir taucht der Anhänger eines LKWs auf. An jeder Ecke des Hängers ist eine polizeiliche Sicherheitskraft positioniert.
Im Laderaum erkenne ich die Uniform eines hochrangigen Beamten. Der Einsatzleiter steht im Inneren. Lässig lehnt er mit dem Rücken an der hinteren Wand des Hängers und erwartet mich. Ich täusche vor, mich gleich ergeben zu wollen, aber verlange als Gegenleistung einen lyrischen Text von ihm. Der Einsatzleiter hebt bedächtig sein Megafon zum Mund und raunt hinein:
"Auf einem kleinen Planeten,
der von uns bestellte,
fragte sich ein Verwandter,
der nicht weit davon lebte,
frohgemut und wohlgemut
ob es denn des Ungemuts genug war."
der von uns bestellte,
fragte sich ein Verwandter,
der nicht weit davon lebte,
frohgemut und wohlgemut
ob es denn des Ungemuts genug war."
Das Gerät verzerrt seine Stimme wie ein Ferngespräch und verleiht ihr einen bedenklichen Unterton. Langsam lässt der Mann sein Megafon sinken.
Mit den Worten des Einsatzleiters in meinem Ohr spaziere ich an allen Uniformierten vorbei und begebe mich zurück zu dem schweren Schiebetor. Während ich das Gedicht, welches mir sehr imponiert, vor mich hin murmele, treffen die ersten Sonnenstrahlen auf den rissigen Asphalt. Hinter dem Tor erkenne ich die Autos, die mit grellen Scheinwerfern über die Straße huschen. Mit jedem Schritt spüre ich das nahende Erwachen stärker. Stetig wiederhole ich das Gedicht und warte darauf, von selbst aufzuwachen.
Als würde ich abheben, löse ich mich von der Traumumgebung und die befahrene Straße vor meinen Augen verblasst.
Mit den Worten des Einsatzleiters in meinem Ohr spaziere ich an allen Uniformierten vorbei und begebe mich zurück zu dem schweren Schiebetor. Während ich das Gedicht, welches mir sehr imponiert, vor mich hin murmele, treffen die ersten Sonnenstrahlen auf den rissigen Asphalt. Hinter dem Tor erkenne ich die Autos, die mit grellen Scheinwerfern über die Straße huschen. Mit jedem Schritt spüre ich das nahende Erwachen stärker. Stetig wiederhole ich das Gedicht und warte darauf, von selbst aufzuwachen.
Als würde ich abheben, löse ich mich von der Traumumgebung und die befahrene Straße vor meinen Augen verblasst.
30. Mai 2012 8.16 Uhr
Ich erwache, aber es dauert noch einige Sekunden, bis ich die Augen öffnen und klar sehen kann.
Ich erwache, aber es dauert noch einige Sekunden, bis ich die Augen öffnen und klar sehen kann.


Jan










